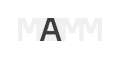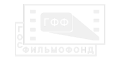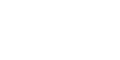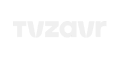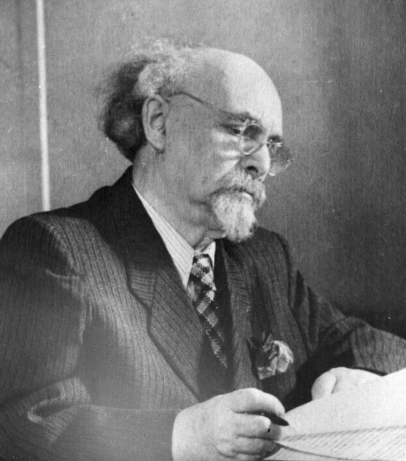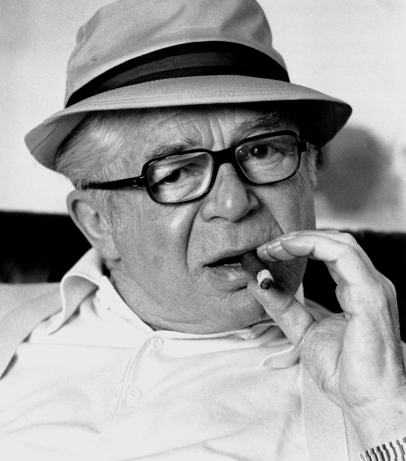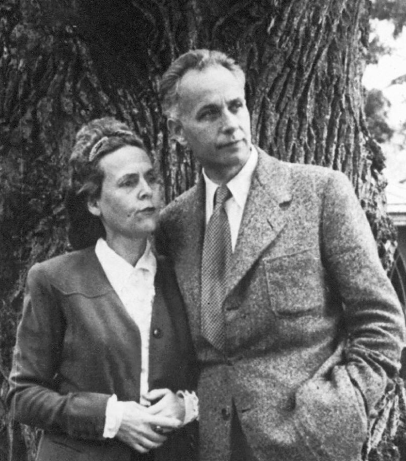Die sowjetische Führung protestierte gegen den Versuch, vom Territorium Österreichs Zehntausende sowjetische Staatsbürger über italienische Häfen in verschiedene Länder Lateinamerikas zu bringen. Offiziell legte die Verwaltung des Bevollmächtigten für Repatriierung beim Ministerrat der UdSSR den Protest ein. Es handelte sich dabei um den Rest der so genannten Russischen Befreiungsarmee (russ. Abk.: ROA) mit General Andrej Wlassow an der Spitze, der noch in Europa geblieben war.
Genaue Angaben zur Anzahl der früheren Wlassow-Soldaten, die sich im Herbst 1946 in der Alpenrepublik aufhielten, gibt es nicht. In den Kriegsjahren waren sie häufig unmittelbar vor Ort und ohne Ermittlungen erschossen worden. Rotarmisten hassten diese als „Verräter“. Viele Tausende ehemalige Wlassow-Kämpfer, die sich oft noch 1941 wegen unüberwindbarer Umstände dem Feind angeschlossen hatten, suchten in verschiedenen Ländern nach Asyl. Die Sowjetunion verlangte von den westeuropäischen Ländern die Abschiebung dieser „Verräter“. Allerdings genossen sie die Unterstützung vieler russischer Immigranten. Unter anderem bat die orthodoxe Auslandskirche Papst Pius XII. um Hilfe.
Der Pontifex protestierte gegen die Zwangsauslieferung der früheren Wlassow-Soldaten, die Asyl beantragt hatten. Allerdings schoben fast alle Länder die ehemaligen Wlassow-Kämpfer ab – verschiedenen Quellen zufolge insgesamt etwa 2,3 Millionen.
In der Sowjetunion wurden nach einem Gesetz vom 18. August 1945 zu sechs Jahren Haft verurteilt und landeten in Straflagern in entlegenen Regionen. Viele von ihnen wurden aber schon in Europa hingerichtet, doch die meisten kehrten quasi heim. Mitte der 1950er-Jahre wurden die meisten Restriktionen, die für die Wlassow-Kämpfer gegolten hatten, abgeschafft. Doch es gab einige Berufe, die sie nicht ausüben durften. Zudem durften sie nicht in sowjetischen Großstädten wie Moskau, Leningrad und einige andere wohnen. Zudem mussten die Verwandten der ehemaligen Soldaten der Russischen Befreiungsarmee leiden. Einstige ROA-Offiziere waren besonders schweren Strafen ausgesetzt, viele wurden hingerichtet. Dasselbe Schicksal wartete auch auf Vertreter des „weißen“ Kosakentums, die häufig quasi vor den Augen der Alliierten nach der Übergabe an die Sowjets erschossen wurden. Das führte zu zahlreichen Protesten. Etwa ein Drittel aller Wlassow-Kämpfer schaffte es, die Abschiebung in die Sowjetunion zu umgehen – sie konnten im Ausland bleiben.
Quelle: Zeitung „Prawda“, Nr. 233 (10315), 30. September 1946